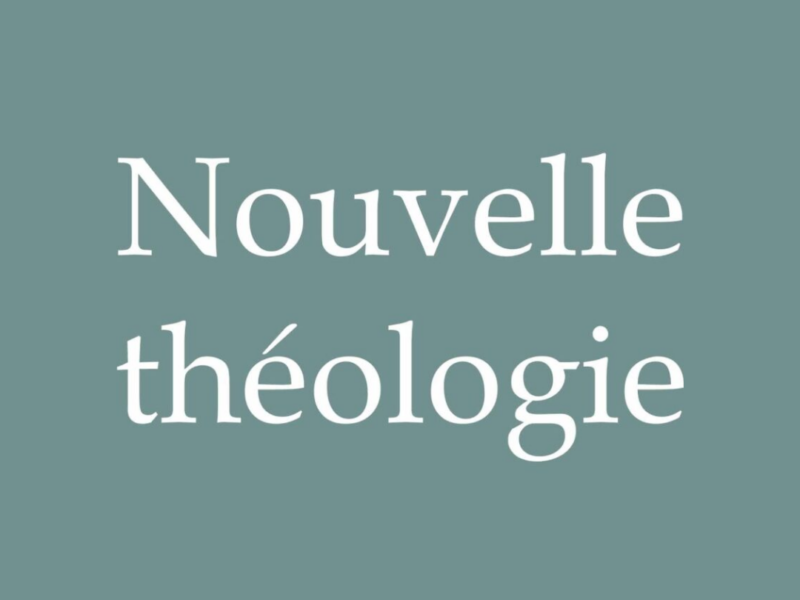Heute vor genau 75 Jahren wurde die Enzyklika Humani generis veröffentlicht, mit der Papst Pius XII. am 12. August 1950 die französische Nouvelle théologie verurteilte. Unter dem Aktenzeichen „Prot. Nr. 293/1946“ finden sich dazu im Archiv des heutigen Dikasteriums für die Glaubenslehre (damals: Heiliges Offizium) höchst spannende Dokumente, zu denen ich hoffentlich bald in einem eigenen Aufsatz veröffentlichen kann.
Am 21. März 1949 war im Hl. Offizium eine Kommission „per lo studio di alcune correnti dottrinali in Francia” eingerichtet worden, der u. a. die Theologen Sebastian Tromp, Franz Hürth, Mariano Cordovani und Pietro Parente angehörten – alles klangvolle Namen aus dem Zentrum der damals vorherrschenden römischen Schultheologie. Tromp verfasste im Oktober 1949 einen ersten Entwurf für diese „Gallia. Instructio“, der bereits mit den Worten Humani generis begann: „Die Spaltung des Menschengeschlechts nicht nur in politischen Dingen, sondern auch auf dem religiösen Feld wurde in unserer Zeit, in welcher die Fundamente der gesamten christlichen Kultur durch das Vordringen von Frevel und Atheismus erschüttert zu sein scheinen, zu einer gewaltigen Quelle des heftigsten Schmerzes.“ Selbst unter Katholik:innen wachse ein „Begehren nach neuen Dingen, welches das Herz des Christentums selbst berührt“ und dem eine entschlossene „Verteidigung der Reinheit des Glaubens“ entgegenzustellen sei.
Weiterer Forschung bedarf die Tatsache, dass im Laufe der Redaktionsarbeiten offenbar ein konkurrierender Entwurf von Pietro Parente auftauchte, der 1942 die Lehrverurteilung der Programmschrift Une école de théologie: Le Saulchoir von M.-Dominique Chenu mit einem offiziösen Artikel im Osservatore Romano sekundierte – dort war vermutlich erstmals von einer „nova teologia“ die Rede. Parentes Entwurf wird schließlich zur Grundlage der späteren Enzyklika, die sich dann auch explizit gegen „verschiedene falsche Meinungen, welche die Fundamente der katholischen Doktrin zu unterminieren drohen“ wandte. Sie verurteilt die vermeintliche „Absicht mancher, die Bedeutung des Dogmas möglichst auszudünnen” explizit als einen „dogmatischen ‚Relativismus’“.
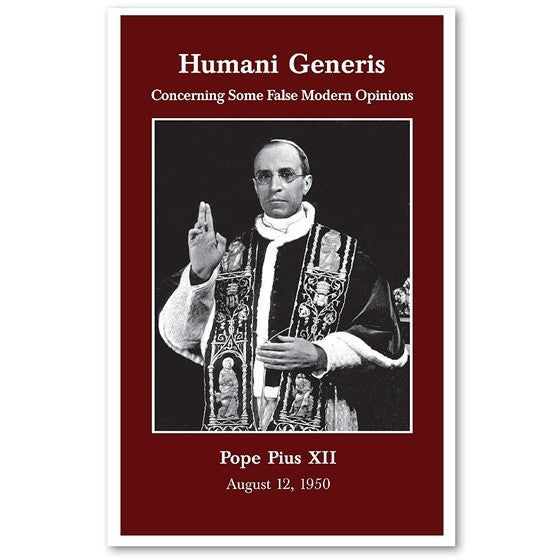
Humani generis beendete die gerade erst beginnende Zusammenarbeit der spirituell-patristischen Jesuiten der Fouvière in Lyon und der kontextuell-thomistischen Dominikaner des Saulchoir in Paris. Diese hätte – organisiert durch Bruno de Solages vom Institut Catholique in Toulouse – die besten Köpfe der damaligen französischen Reformtheologie in einem neuen Handbuch zusammengebracht, das in der gemeinsamen Rückkehr zu den Quellen von Patristik und Thomismus („Ressourcement“) unter dem pastoralen Anspruch der Gegenwart („Aggiornamento“) ein epochaler Meilenstein der Theologiegeschichte im 20. Jahrhundert hätte werden können.
Henri de Lubac erinnert an den Aufbruch dieser ’neuen‘ Theologie: „Wir stellen sie uns zugleich weniger systematisch und tiefer in der Tradition verwurzelt vor, sie sollte das Beste des Jahrhunderts auf den Gebieten der Exegese, Patristik, Liturgie, Geschichte, philosophischer Reflexion miteinbeziehen… […] Das Bedürfnis danach war groß, doch die Umstände nicht günstig. […] Dann hat der Blitzschlag von Humani generis das Projekt begraben.“ M.-Dominique Chenu ergänzt konkrete Inhalte des Handbuchprojekts: „Ich […] zeichnete die ersten Spuren […] eines eschatologischen Sinns, d. h. […] einer Dynamik der Hoffnung nach, den ich […] aufkommen sah – zwar nicht bei den großen Theologen, wohl aber bei den kleinen Leuten im christlichen Volk. Meine Partner und ich beobachteten all das mit großer Hoffnung und Freude. Und dann erschien Humani generis. Unserer kleinen Arbeitsgruppe blieb nichts anderes übrig als die Türen zu schließen. […] Die Atmosphäre nahm uns die Luft zum Atmen.“